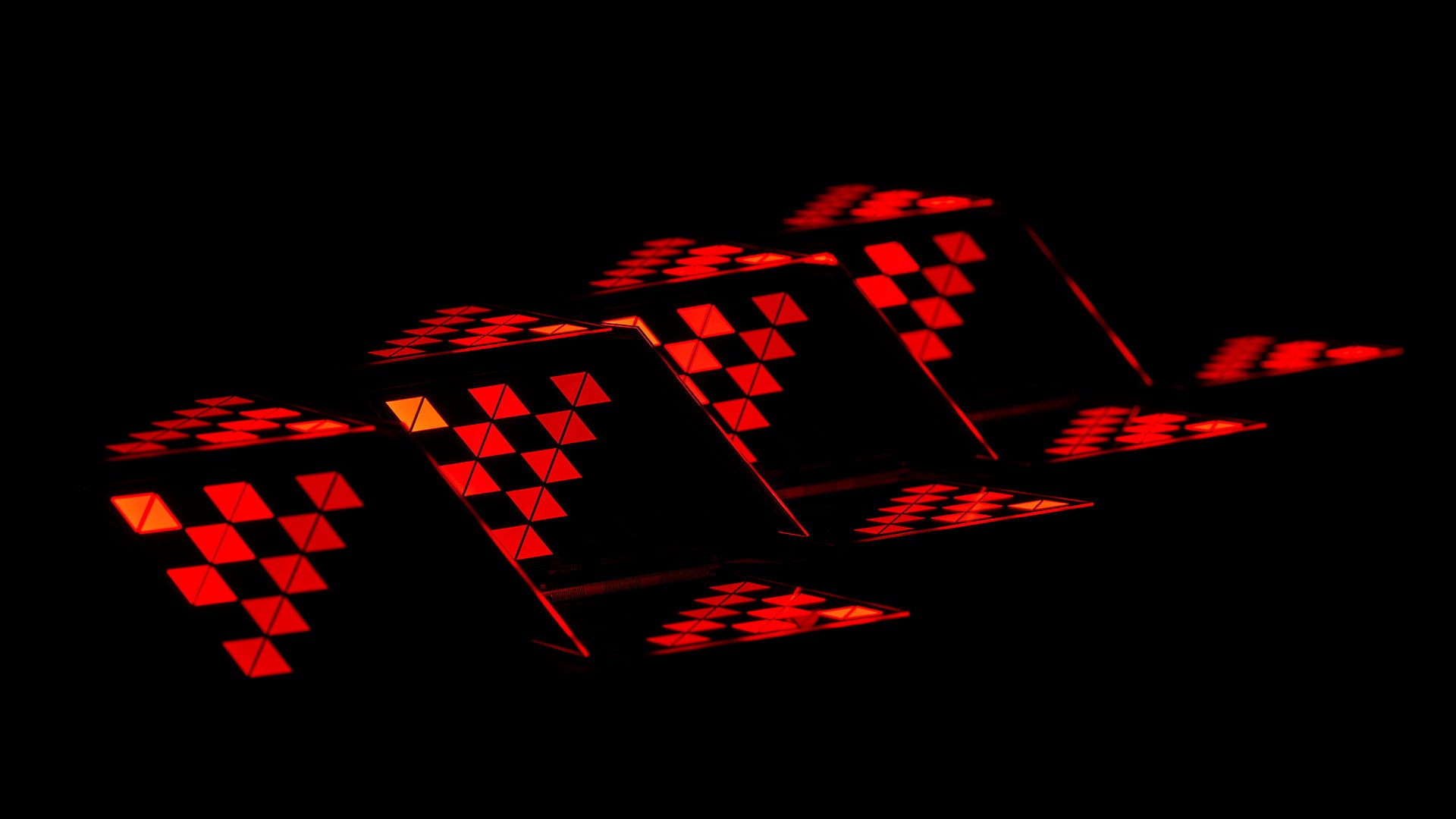.jpg)
Innovation
Audi wandelt sich. Kontinuierlich. Entdecken Sie hier, wie unsere Innovationen „Vorsprung durch Technik“ sichern, moderne Technik und fortschrittliches Denken das Unternehmen Audi auszeichnen, welche Prozesse dahinterstecken und wie unsere Ingenieurteams daran arbeiten, Bestehendes weiterzuentwickeln.